Kaum hatte sich Friedrich Merz beim NATO-Gipfel in Brüssel in die Front der bedingungslos Atlantischen eingefädelt – mit einer Loyalitätsrhetorik, die selbst den notorischen Bücklingen früherer Kanzler Konkurrenz machte –, da wurde im Bundestag zur innenpolitischen Disziplinierung geblasen. Während in Brüssel das Bild einer militärisch einheitlich orchestrierten Außenpolitik gezeichnet wurde, in der Deutschland sich als folgsame Gliederung des westlichen Verteidigungskörpers versteht, inszenierte man in Berlin ein anderes Schauspiel: die Exkommunikation einer demokratischen Opposition.
Die Nichtwahl der Fraktionsvorsitzenden der Linken, Heidi Reichinnek, ins Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) war kein Betriebsunfall, keine Laune parlamentarischer Geometrie, sondern ein kalkulierter Affront – ja, ein Machtakt. Wer glaubt, es sei lediglich um »Persönlichkeitsprofile« oder »Eignungsfragen« gegangen, verkennt die politische Dramaturgie: Es handelte sich um ein öffentliches Schaugefecht, gerichtet gegen eine Partei, die unbequem ist – und gegen eine Politikerin, deren politische Biografie nicht korrumpierbar scheint.
Die doppelte Bühne: Brüssel und Berlin
Was als Parlamentsposse verkauft wurde, ist in Wahrheit ein symbolischer Machtbeweis im Schatten transatlantischer Selbstverkleinerung. Die Bilder aus Brüssel zeigen Merz an der Seite von Mark Rutte, dem neuen NATO-Generalsekretär, der dort mit römischen Sprichwörtern (»Si vis pacem, para bellum«) und markigen Worten (»Unite, innovate, deliver«) eine Verteidigungsgemeinschaft aufrüstet, die kaum noch zwischen Realpolitik und Missionsbewusstsein unterscheidet. Es war ein Gipfel der Einordnungen – nach oben.
Zuhause aber, im Bundestag, wurde demonstriert, wer dazugehört – und wer nicht. Dass ausgerechnet jene Fraktionsvorsitzende ausgeschlossen wurde, die wenige Wochen zuvor mit ihrer Zustimmung zum zweiten Wahlgang Merz’ Kanzlerschaft ermöglicht hatte, ist nicht Ironie, sondern politische Choreografie. Die Botschaft: Dank wird in diesem System nicht mit Mitbestimmung, sondern mit Misstrauen vergolten.
Der Schleier der »Eignung«
Die Union behauptet, Reichinnek sei nicht geeignet für das PKGr. Eine Abgeordnete, die – wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann betonte – ein »offensichtlich gestörtes Verhältnis zum Eigentum« habe, könne kein Vertrauen genießen. Impliziert wird: Kapitalismuskritik ist gleich Verfassungsfeindlichkeit. Wer das Recht auf Eigentum nicht heilsgeschichtlich verehrt, ist für die Aufsicht über Geheimdienste untragbar.
Es ist ein bemerkenswerter Kurzschluss: Aus einer gesellschaftspolitischen Position wird ein sicherheitspolitisches Risiko konstruiert. So verwandelt sich eine linke Sozialpolitikerin zur Gefahr für den Staat. Die Logik dahinter ist nicht neu. Wer im politischen Diskurs stört, wird als potentiell unzuverlässig markiert. Die Exklusion erfolgt nicht trotz demokratischer Standards, sondern im Namen derselben.
Der Fall Reichinnek ist nicht singulär. Er steht exemplarisch für eine Demokratie, die sich zunehmend über Zugangskontrollen definiert. Die parlamentarische Repräsentation wird zur Veranstaltung für Angehörige des kompatiblen Spektrums. Wer als zu weit links, zu unbequem oder zu strukturell kritisch gilt, wird formal korrekt ausgezählt. Der Verdacht ersetzt den Diskurs.
Dabei war es parlamentarischer Usus, dass alle Fraktionen – mit Ausnahme offen verfassungsfeindlicher Gruppierungen – im PKGr vertreten sind. Dass die AfD dabei keine Mehrheit fand, lässt sich verfassungspolitisch begründen. Doch die Linke? Eine demokratisch legitimierte Fraktion, deren Vorsitzende als »beliebt und anerkannt« gilt, wie selbst politische Gegner einräumen? Hier wird deutlich: Es geht nicht um Sicherheit, sondern um Symbolik. Nicht um Kontrolle, sondern um Kontrolle über die Kontrolle.
Koalitionen des Schweigens
Auffallend war das Schweigen der Ampel. Zwar äußerten sich einzelne Grüne und Sozialdemokraten zugunsten Reichinneks. Doch ein deutliches Zeichen blieb aus. Kein Appell an parlamentarische Fairness. Kein gemeinsames Eintreten für die Institutionenbalance. Die Angst, ins Fadenkreuz unionsnaher Medien zu geraten, wog offenbar schwerer als das Bewusstsein für demokratische Kultur.
Wer schweigt, stabilisiert. Die taktische Zurückhaltung der SPD wird umso fragwürdiger, als sie demnächst selbst auf Zweidrittelmehrheiten angewiesen sein wird: bei der Schuldenbremse, bei der Wahl von Verfassungsrichter:innen. Ohne die Linke geht das nicht. Und diese Linke hat nun eindrücklich gelernt, dass parlamentarisches Entgegenkommen nicht belohnt, sondern als Schwäche ausgelegt wird.
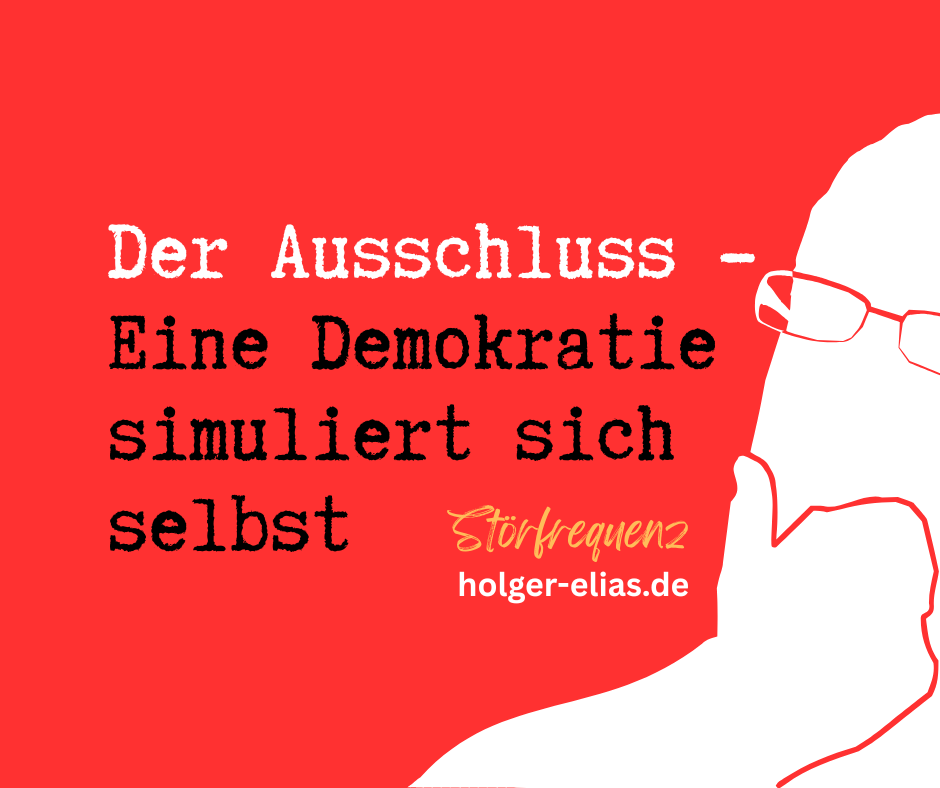
Postdemokratie mit Mehrheitsbeschluss
Das PKGr ist kein beliebiger Ausschuss. Es ist die letzte parlamentarische Instanz, die den geheimdienstlichen Staat im Zaum halten soll. Ein Gremium, das durch Verschwiegenheit, Integrität und Pluralität legitimiert ist. Wenn hier politische Homogenität das neue Auswahlkriterium wird, verwandelt sich Kontrolle in Simulation. Dann wird nicht mehr überwacht, sondern begleitet. Nicht kontrolliert, sondern eingebunden.
Die neue Zusammensetzung macht deutlich: Wer über Jahre mit kritischen Fragen auffiel – wie Roderich Kiesewetter oder Marja-Liisa Völlers – wurde nicht erneut nominiert. Stattdessen sitzen nun vier Neulinge im Gremium. Die Folge: weniger Expertise, weniger Widerstand, weniger Kontrolle. Die Handlungsfähigkeit des PKGr ist durch diese Entparlamentarisierung nicht gewährleistet, sondern massiv geschwächt.
Von der Opposition zur Gefahrenquelle
Reichinnek steht exemplarisch für eine neue Oppositionsgeneration: rhetorisch versiert, strategisch klug, sozial verankert. Wer sie aus dem Gremium drängt, will ein politisches Exempel statuieren. Dass ausgerechnet sie – die architektonische Vermittlerin der Kanzlerwahl – zur Persona non grata erklärt wird, zeigt den zunehmenden Mangel an politischem Anstand.
Ihre Haltung zur NATO, zur Aufrüstung, zur sozialen Frage macht sie für eine politische Elite untragbar, die ihre eigene Existenz längst als Sachzwang begreift. Wer wie Reichinnek Systemfragen stellt, landet auf der Bank. Es ist die alte Regel autoritärer Systeme: Wer nicht mitspielt, fliegt raus. Nur dass es hier nicht Generäle, sondern Generalsekretäre sind, die den Ton angeben – im Inland wie im transatlantischen Schulterschluss.
Kontrollverlust durch Machtsicherung
Der Widerspruch ist offensichtlich: Ausgerechnet ein Gremium, das für Checks and Balances geschaffen wurde, wird zum Schauplatz politischer Einfältigkeit. Kontrolle, so scheint es, ist nur erwünscht, solange sie nicht wehtut. In einer Demokratie ist das ein Alarmzeichen. Und wenn dieses Signal ausgerechnet von jenen ausgeht, die sich über »Staatsversagen« und »Vertrauensverlust« beklagen, dann wird es zur Farce.
Was bleibt? Eine Regierung, die sich in Brüssel als transatlantischer Musterschüler geriert – und zu Hause jene Stimmen mundtot macht, die sie an die Verfassung erinnern könnten. Eine SPD, die sich selbst demontiert. Eine Grünen-Fraktion, die über Bürokratie staunt, aber keine Grundrechte verteidigt. Und eine Opposition, der die Spielregeln über Nacht neu geschrieben werden.
In der alten Weltbühne stand einst geschrieben: »Wenn man euch sagt, ihr sollt euch ruhig verhalten, dann fragt: Warum?« Heute fragen wir: Warum darf eine demokratisch gewählte Abgeordnete nicht über die Dienste wachen, die selbst ständig den Rahmen demokratischer Kontrolle ausloten?
Weil sie nicht angepasst ist. Weil sie nicht mitmacht. Weil sie erinnert, dass Demokratie mehr ist als formale Beteiligung. Der Ausschluss Reichinneks ist darum nicht nur ein Angriff auf eine Politikerin, sondern ein Symptom für ein System, das sich die Demokratie zu oft als Pose leistet.
Wer Demokratie wirklich will, muss sie aushalten. Auch wenn sie widerspricht. Gerade dann.
