Wie soziale Teilhabe zur staatlichen Arbeitsreserve verkommt. Ein Essay gegen das Dienstpflichtregime der Ungleichheit. Von Holger Elias

Es beginnt – wie so oft – mit einem Wort, das harmlos klingen will und doch bereits von ideologischer Sprengkraft durchdrungen ist: Pflicht. Die Pflicht ist die kleine Schwester der Tugend, sie tritt stets im Gewand des Guten auf, des Gemeinwohls, des moralisch Gebotenen. Aber wehe dem, der sie verweigert – denn hinter ihr lauert nicht selten die Ordnungsmacht, die Bestrafung, der Ausschluss. Und während sich Deutschlands politische Klasse – quer durch CDU, CSU, FDP und AfD, gelegentlich sekundiert von sozialdemokratischen Spätmoralisten – wieder einmal dem Traum eines »allgemeinen Pflichtdienstes« hingibt, wäre es an der Zeit, den Staub von den alten Texten zu pusten: von den Eingaben an das Reichsarbeitsministerium, den Erlassen zur »Volksgemeinschaft«, den Verwaltungsakten der Zwangsdienste vergangener Jahrhunderte.
Denn was heute als »soziale Innovation« verkauft wird, ist in Wahrheit ein Rückfall in die autoritäre Fantasie des Staates als Arbeitsdirigent – und der Bürgerin, des Bürgers als Reservepersonal. Die Rhetorik mag sich gewandelt haben. Die Mechanik nicht.
Der Vorschlag, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für junge Menschen einzuführen – sei es im sozialen Bereich, bei der Feuerwehr oder im Pflegeheim –, hat Konjunktur. Der CDU-Generalsekretär fordert »mehr Gemeinsinn«. Die FDP hält es für »charakterbildend«, wenn junge Menschen früh lernen, »etwas zurückzugeben«. Die AfD wiederum möchte den »verweichlichten Nachwuchs« am liebsten gleich in Uniform sehen. Und was nach bürgerschaftlichem Pathos klingt, ist bei näherem Hinsehen nichts anderes als ein ideologisches Klassenprojekt. Denn die Freiheit zur Freiwilligkeit ist eine soziale Frage.
Wer sich ein Jahr Auszeit leisten kann, ein soziales Engagement in Costa Rica, die Pflegearbeit in Tansania oder den Biohof in der Uckermark – der wird ausgenommen von der Pflicht. Er oder sie leistet ohnehin »einen wertvollen Beitrag«. Wer aber keine Wahl hat, keine Mittel, keine Lobby, der soll, bitteschön, »dem Land etwas zurückgeben«. Das klingt wie ein Dankesbrief mit Arbeitsnachweis. Es ist jedoch nichts anderes als die Rückkehr der Dienstbarkeit – diesmal nicht für einen Fürsten, sondern für die Verwaltung.

Die Begriffswahl ist dabei kein Zufall. Das »soziale Pflichtjahr« wird in Papieren und Talkshows nicht etwa als Notlösung präsentiert, sondern als hehre Idee. Man spricht von »Zusammenhalt«, von »Verantwortung«, von der »Chance, über sich hinauszuwachsen«. Die Ministerialprosa liebt es, wenn Zwang nach Abenteuer klingt. Eine Pflicht wird zum Bildungsversprechen, eine strukturelle Schieflage zum pädagogischen Projekt.
Aber wem nützt es?
Man betrachte die Lage der Pflege: Zehntausende unbesetzte Stellen, schlechte Bezahlung, hoher Krankenstand. Der Markt will nicht zahlen, also soll die Republik liefern – nicht mit Geld, sondern mit Körpern. Ebenso beim Katastrophenschutz, in Tafeln und Obdachlosenunterkünften: Überall fehlen Helfer:innen. Warum? Weil Arbeit, die Care heißt, schlecht bezahlt und wenig anerkannt wird. Und nun sollen ausgerechnet jene, die kaum Ressourcen besitzen, diese Versorgungslücken stopfen – unter dem Deckmantel des Gemeinschaftssinns.
In Wahrheit ist es der Sozialstaat, der sich hier selbst entlastet: durch eine ideologische Umetikettierung von Arbeit in »Engagement«. Der Pflichtdienst dient nicht dem Menschen, sondern der Lückenbürokratie. Er ist eine Verfügbarmachung unter dem Vorwand der Erziehung.
Man wird einwenden: Aber die Wehrpflicht war doch auch für alle. Auch der Zivildienst war ein Dienst an der Gesellschaft. Stimmt. Und doch war selbst dort die soziale Selektivität allgegenwärtig. Akademikerkinder hatten bessere Chancen, sich zu entziehen, sich freistellen zu lassen, klüger zu argumentieren. Wer nicht wusste, wie man einen Gewissenskonflikt schriftlich darlegt, wurde eingezogen. Der Klassencharakter der Dienstpflicht war nie ein offizieller, aber stets ein praktischer.
Die neue Variante geht noch einen Schritt weiter. Sie will, dass junge Menschen sich nicht aus moralischer Überzeugung, sondern aus pflichtgemäßem Gehorsam einfügen. Das ist keine Pädagogik, sondern autoritäre Erziehungspolitik. Und sie beginnt da, wo gesellschaftliche Hierarchien am stärksten wirken: bei jenen, die wenig haben und sich nicht entziehen können.
Der Gedanke, den Menschen in eine staatlich definierte »nützliche Rolle« zu zwingen, hat eine lange Geschichte. Man nannte es »Arbeitspflicht« im Deutschen Kaiserreich, »Reichsarbeitsdienst« unter Hitler, »sozialistische Pflicht« in der DDR. Immer wieder wurde der Einzelne nicht als Souverän, sondern als Werkzeug begriffen – als Rädchen im Getriebe einer Ordnung, die sich selbst zum höchsten Gut erklärte.
Heute mag das alles freundlicher klingen – das Ziel aber bleibt ähnlich: Disziplinierung durch Arbeit, moralische Aufladung durch staatliches Dekret, Legitimation von Ungleichheit durch »Pflicht«. Wer sich verweigert, riskiert soziale Ächtung. Wer sich einfügt, bekommt den Trostpreis der »Teilhabe«.
Dabei zeigt jede ernstzunehmende Sozialforschung: Teilhabe entsteht nicht durch Zwang, sondern durch Befähigung. Wer Menschen zur Teilnahme drängt, aber ihnen keine Perspektive gibt, degradiert sie zu Staffage einer Politik, die ihre Versäumnisse in Erziehung auslagert.
Was sagen die Verfassungsrechtler? Einige warnen. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach betont: In Friedenszeiten darf kein allgemeiner Arbeitsdienst eingeführt werden, der gegen den Willen des Einzelnen erfolgt. Die Menschenwürde gebietet es, dass niemand zur Erfüllung staatlicher Zwecke instrumentalisiert wird. Doch diese Einsprüche verhallen im medialen Trommelfeuer. Wenn »Pflicht« nach Fortschritt klingt, werden Grundrechte zum Betriebsunfall erklärt.
»Was als demokratische Erziehung verkauft wird, ist in Wahrheit eine Entmündigung.«
Und die Medien? Sie jubeln mit. Die Talkshows debattieren nicht über Zwang, sondern über »Verantwortung«. Die Feuilletons schreiben von der »Generation Ich«, die wieder lernen müsse, dass Freiheit nicht gratis sei. Und kaum jemand fragt, warum es immer wieder die gleichen Klassen sind, denen man die »Pflicht zur Dankbarkeit« abverlangt.
Am perfidesten aber ist der pädagogische Zungenschlag: Der Pflichtdienst als Chance. Als Charakterbildung. Als »Horizonterweiterung«. Die Jugend wird zur Projektionsfläche einer erwachsenen Ordnung, die sich selbst entglitten ist. Anstatt junge Menschen zu fördern, will man sie formen. Der Staat tritt als Erzieher auf – nicht mit offenen Fragen, sondern mit klaren Befehlen. Was als demokratische Erziehung verkauft wird, ist in Wahrheit eine Entmündigung.
Gibt es Alternativen? Natürlich. Ein freiwilliges soziales Jahr, gut bezahlt, mit echter Perspektive. Eine Ausbildungsoffensive im sozialen Sektor. Eine Umverteilung, die nicht auf Demut, sondern auf Gerechtigkeit setzt. Doch all das kostet Geld, Mut und politisches Rückgrat. Stattdessen ruft man die Armen zur Pflicht – und hofft, dass sie es nicht merken.
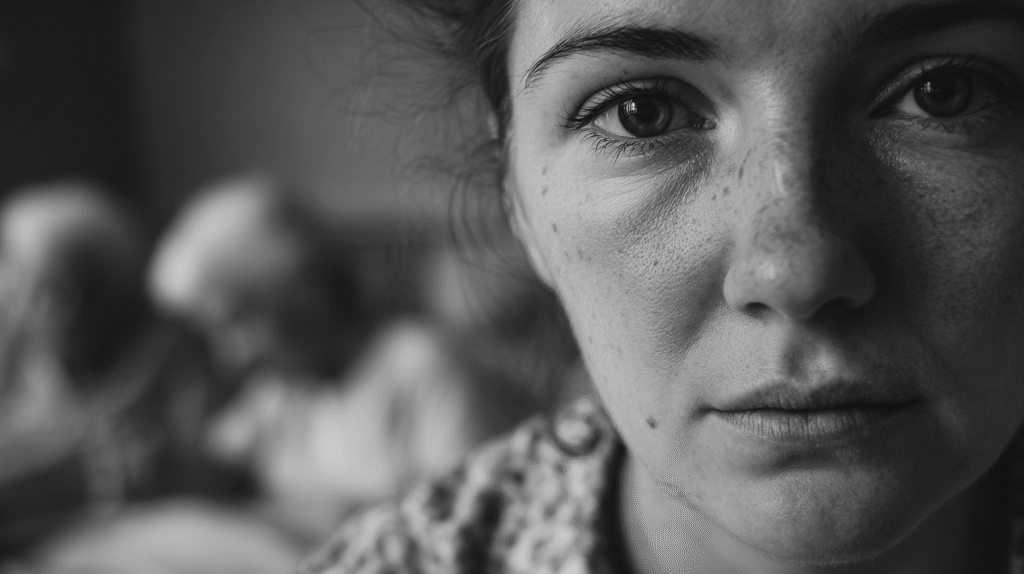
Dabei merken sie es längst.
Ein junger Mann aus Gelsenkirchen, 19 Jahre alt, schreibt auf Instagram: »Ich soll ein Jahr lang in einem Altenheim arbeiten – unbezahlt, damit ich Bürger bin? Was war ich vorher?« Eine junge Frau aus Jena, 18 Jahre, kontert: »Ich will gerne helfen. Aber freiwillig. Und nicht, weil man mir droht, dass ich sonst keine Ausbildung bekomme.«
Das ist der Punkt.
Wer helfen will, braucht keine Pflicht. Wer zwingt, will keine Hilfe, sondern Kontrolle. Es ist an der Zeit, dieses ideologische Konstrukt zu durchschauen: Der Pflichtdienst ist kein soziales Projekt, sondern ein autoritärer Reflex. Er ist die staatliche Antwort auf einen Markt, der versagt – und ein Ausdruck jener neoliberalen Phantasie, nach der sich jeder Mensch nützlich machen muss, um sein Existenzrecht zu behalten.
Was der Staat den Menschen schuldet, ist nicht eine Pflicht, sondern ein Recht: auf Teilhabe, Würde und Freiwilligkeit.
In einem wirklichen Sozialstaat – in einem demokratischen Gemeinwesen, das sich nicht nur so nennt – müsste der Satz lauten: »Wer gibt, darf fordern. Und wer nichts geben kann, verdient trotzdem Respekt.« Doch dieser Satz ist aus der Mode gekommen. An seine Stelle tritt die neue alte Parole: »Du bist nur etwas wert, wenn du dienst.«
Sie klingt vertraut. Und gerade deshalb müssen wir ihr widerstehen.
